Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Bandscheibenvorfall Symptome: Wie erkenne ich einen Bandscheibenvorfall, was hilft und wie beuge ich vor?
Was ist ein Bandscheibenvorfall – in welche Richtung verschiebt sich der Kern?
Unsere Bandscheiben bestehen aus Bindegewebe und einem gallertartigen Kern. Er sorgt dafür, dass unsere Wirbelsäule beweglich bleibt und dient als Puffer. Bei einer Belastung verschiebt sich der Kern in verschiedene Richtungen: nach vorn und nach hinten. Im Alter verliert unsere Bandscheibe an Elastizität, unser schützender Faserring kann Risse bekommen. Durchbricht dann der gallertartige Kern den Rahmen aus Bindegewebe, kommt es zum Bandscheibenvorfall (Diskushernie). Dabei kann der Gallertkern zu einer Quetschung der Nervenwurzeln führen, was sehr schmerzhaft ist.
Wo und wann tritt der Bandscheibenvorfall in der Regel am häufigsten auf?
Je älter wir werden, umso häufiger leiden wir unter Bandscheibenproblemen. Meist tritt ein Bandscheibenvorfall zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Mit über 90 Prozent der Bandscheibenvorfälle ist die Lendenwirbelsäule (LWS) am anfälligsten. Das liegt vor allem daran, dass sie die Hauptlast unseres Körpers trägt. Gerade mal zehn Prozent der Bandscheibenvorfälle ereignen sich an der Halswirbelsäule (HWS). Kaum betroffen ist die Brustwirbelsäule (BWS). Selten kommt es zu einem Bandscheibenvorfall nach einem Unfall. Meist ist die Bandscheibe dann bereits vorgeschädigt. So kann eine Quetschung der Nervenbahnen einen schweren Schaden verursachen, gegebenenfalls ein Querschnittsyndrom.
Welche Ursachen und Symptome hat ein Bandscheibenvorfall?
Degenerativ bedingte Veränderungen in unseren Bandscheiben sind die Hauptursache von Bandscheibenvorfällen. Das ist schlichtweg eine Folge unseres Alterungsprozesses. Eine gewichtige Rolle spielt zudem die genetische Prädisposition. Verlässt der gallertartige Kern seinen angestammten Platz und wandert in Richtung Nervenbahnen, kann das sehr schmerzen. Das kommt vor allem bei Reibungen und Druck auf das Rückenmark vor. Die Symptome hängen wiederum davon ab, wo die Diskushernie auftritt. Je nach Schwerpunkt strahlen die Schmerzen in verschiedene Richtungen aus. Bei einem Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich verspüren wir Schmerzen im Bein. Im Halswirbelbereich hingegen haben wir Schmerzen im Arm. Dabei können auch neurologische Ausfälle auftreten. Bei einem schweren Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich kann zudem das sogenannte Cauda-Equina-Syndrom auftreten. Das Phänomen hat Inkontinenz, Blasen- oder Afterlähmung zur Folge. Die häufigsten Symptome bei einem Bandscheibenvorfall der LWS sind:
- scharfer, stechender Schmerz im unteren Rücken, ausstrahlend über das Gesäss bis in die Kniegelenke
- verhärtete Muskulatur
- Kribbeln, Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühle
Häufige Symptome der Diskushernie der HWS sind:
- Nackenschmerzen, ausstrahlend in den Arm
- Minderung der Reflexe, Kribbeln, Taubheitsgefühle in den Armen, Händen, Fingern
- verhärtete Muskulatur
- Querschnittsyndrom bei entzündeten Nerven mit Auswirkung auf das Rückenmark
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
 Urdorf
UrdorfPhysiotopia Urdorf
PremiumSteinackerstrasse 63, 8902 UrdorfPhysiotopia Urdorf wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet510 Bewetungen0447... Nummer anzeigen 044 734 21 28 *CHF/h 20.- -
 Zürich
ZürichVivid Physio GmbH
PremiumWinterthurerstrasse 60, 8006 Zürich0 Bewetungen0434... Nummer anzeigen 043 437 77 33 * -
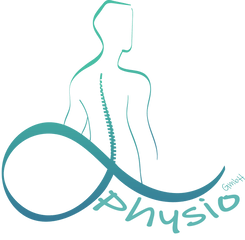 Zürich
ZürichAlpha-Physio Zürich GmbH
PremiumBergstrasse 109, 8032 ZürichAlpha-Physio Zürich GmbH wurde mit 4.7 von 5 Sternen bewertet4.71 Bewetungen0432... Nummer anzeigen 043 243 66 03 *
Wie diagnostiziert ein Arzt einen Bandscheibenvorfall?
Zur Diagnose eines Bandscheibenvorfalls greifen Ärzte gern auf MRI (Magnetic Resonance Imaging) zurück. Das MRI stellt das Ausmass der Diskushernie und die beeinträchtigten Nervenwurzeln bildlich dar. Auf einem Röntgenbild ist eine Diskushernie nicht zu erkennen. Zudem ist ein MRT (Kernspintomographie) ein beliebtes Schnittbildverfahren, um den Zustand der Bandscheiben und Nerven zu beurteilen. In seltenen Fällen setzt der Arzt eine Myelografie ein. Das invasive Verfahren mit dem Einspritzen von Kontrastmitteln in den Wirbelkanal ermöglicht es, Nervenwurzeln genau zu beurteilen. Die Computertomographie wird beim Verdacht auf eine Verkalkung oder Verknöcherung angewandt.
Was kann ich gegen einen Bandscheibenvorfall tun – wie erhalte ich meine Reflexe?
Bei den meisten Bandscheibenvorfällen genügt eine konservative Behandlung. Sie lindert Schmerzen und behebt eventuelle neurologische Ausfälle. Je nachdem, wie schwer die Symptome und Reibungen beim Bandscheibenvorfall sind, genügt eine Verlagerung der Körperpositionen. Bei einer Diskushernie in der LWS helfen in der Regel drei Tage Bettruhe in Böcklilagerung sowie entzündungs- und schmerzhemmende Medikamente. Zur Stärkung der Wirbelsäule verschreibt der Arzt zusätzlich Physiotherapie. Nach ein paar Wochen können sich über 90 Prozent der Patienten wieder beschwerdefrei bewegen.
Wann brauche ich einen Eingriff mit einem Operationsmikroskop?
Schlägt die konservative Behandlung nicht an, ist eine Operation oft unumgänglich. Meist wird der Bandscheibenvorfall über einen kleinen Zugang mikrochirurgisch entfernt. Am häufigsten erfolgen diese Operationen im Lendenwirbelbereich mit einem Operationsmikroskop. Der Vorteil der mikrochirurgischen Operationsmethode mit einem hochleistungsfähigen Operationsmikroskop ist, dass Gewebeschädigungen begrenzt sind. In der Regel kann der Patient nach einem Eingriff mit dem Operationsmikroskop nach etwa drei bis sechs Tagen das Spital verlassen. Nach weiteren drei Monaten sollte der Patient wieder normal belastbar sein.
Welche Risikofaktoren begünstigen Reibungen und eine Diskushernie?
Neben der genetischen Prädisposition und Verschleisserscheinungen mit fortschreitendem Alter gibt es zusätzliche Risikofaktoren für einen Bandscheibenvorfall. Dazu zählen:
- Übergewicht
- permanente Fehlhaltungen, wie beispielsweise zu langes Sitzen
- regelmässige Überlastungen durch das Heben schwerer Lasten
- Bewegungsmangel
- schwache Rückenmuskulatur
Der Physiovergleich für die Schweiz. Finde die besten Physiotherapeuten in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Physiotherapeuten
Das könnte dich auch interessieren
In 7 Schritten ein Handgelenk tapen
Ein stabiles Handgelenk ist wichtig, um alle Bewegungen der Finger und der Hand ausführen zu können. Lässt die Stabilität nach, treten Beschwerden, Reizungen, Verspannungen und ähnliche Schmerzen auf. Dann ist es erforderlich, das Handgelenk zu tapen und so zu entlasten. Auch bei Sportverletzungen ist die Fixierung des Gelenks wichtig und vermeidet eine weitere Belastung. Das Tapen ist durch das Winkeln einer Bandage, durch Tapes oder durch flexible Stretchbänder möglich.
Fersenschmerzen: Wenn jeder Schritt zur Qual wird
Du leidest an unerklärlichen Fersenschmerzen und kennst es, wenn jeder Schritt zur Qual wird? Möglicherweise ist ein Fersensporn der Auslöser für die Schmerzen. Natürlich gibt es aber auch noch andere Erkrankungen, bei denen die Ferse in Mitleidenschaft gezogen ist. Diese Beschwerden können deinen Alltag stark beeinträchtigen. In akuten Fällen ist es möglich, dass du nicht richtig auftreten und nur den Vorderfuss belasten kannst. Umso wichtiger ist es, dass du die Ursachen für deine Fersenschmerzen schnell von deinem Hausarzt oder einem Orthopäden abklären lässt.
Bandscheibenvorfall Operation - Methoden und Heilungschancen
Bandscheibenvorfälle sind Erkrankungen an der Wirbelsäule, bei denen ein Teil des Bandscheibenkerns austritt und für Schmerzen sorgt. Die Gründe für die Erkrankung sind vielfältig, wurzeln jedoch oftmals in einer Fehlhaltung oder Übergewicht. Zudem werden Bandscheibenvorfälle meist durch falsches Heben und Tragen, eine untrainierte Rückenmuskulatur oder familiäre Vorbelastungen ausgelöst. Zusätzlich kann es jedoch auch durch Wirbelsäulenveränderungen aufgrund von Tumoren oder entzündlichen Erkrankungen zu Bandscheibenvorfällen kommen. Doch wie werden Bandscheibenvorfälle behandelt, wann ist eine Operation ratsam und wie gut stehen die Heilungschancen?
Knick-Senkfuss: Woher kommt die Fehlstellung, wie erkenne ich sie und was kann ich gegen Plattfüsse tun?
Ein normaler Fuss hat in der Innenseite ein Längsgewölbe, das nicht auf dem Boden aufliegt. Durch das Fussgewölbe drückt unser Körpergewicht nicht komplett auf die Fusssohle. Es lastet zu einem Drittel auf dem Fussballen und zu zwei Dritteln auf der Ferse. Bei schwacher Fussmuskulatur senkt sich unser Fussgewölbe ab zum Senkfuss oder Plattfuss. Meist knickt der Senkfuss nach innen ein. Dann haben wir einen Knick-Senkfuss. Ganz normal ist er allerdings bei Babys. Da ist der Knick-Senkfuss Teil der Entwicklungsstufe, weil das Fussskelett noch nicht vollständig ausgebildet ist. Was du über Knick-Senkfüsse, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten wissen musst, erfährst du hier.
Wie viele Knochen hat ein Mensch? Und gibt es da Unterschiede?
Wie viele Knochen hat ein Mensch? Zugegeben: Die Frage klingt banal, aber in Anbetracht der Komplexität des menschlichen Skeletts auch wieder interessant, denn nicht alle Menschen haben gleich viele Knochen. Ausserdem gibt es bei nahezu allen Wirbeltieren Knochen, die eine gleiche Entwicklungsgeschichte haben. Bei Walen finden sich etwa in den Flossen rudimentäre Fingerknochen- beziehungsweise Vorderfussanlagen. Die menschlichen Gehörknöchelchen existieren in anderer Form in Reptilien, Amphibien und Vögeln als Teile des Kiefers und Schädels. Nicht zuletzt ist die Frage „Wie viele Knochen hat ein Mensch?“ ein wunderbarer Einstieg in die Anatomie.
„Schmerzen unterer Rücken“ erkennen und behandeln
Schmerzen im unteren Rückenbereich führen oft dazu, dass du dich kaum noch schmerzfrei im Alltag bewegen kannst. Jedes Aufstehen, Gehen oder Bücken tut plötzlich weh, der Oberkörper und die Oberarme möchten auch nicht mehr so richtig mitmachen. Was hinter „Schmerzen unterer Rücken“ steckt, was du unternehmen kannst und welche Behandlungsmethoden dir helfen, liest du hier.
